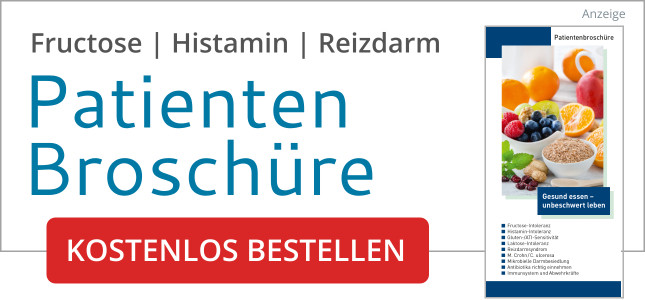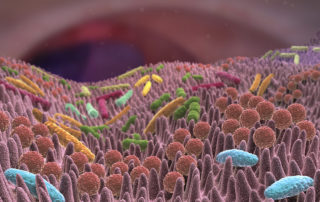Wenn Darmbakterien die Medizin sabotieren
Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum es so viele Medikamente gegen ein und dieselbe Krankheit gibt? Und warum ein bestimmter Wirkstoff bei einem Patienten hilft und beim anderen nicht? Die Ursache für die unterschiedliche Wirksamkeit von Medikamenten könnte an der individuellen Zusammensetzung unserer Darmbakterien liegen.
Die Medikamente, die wir einnehmen, werden unter Umständen von Bakterien abgebaut noch bevor sie ihren Wirkungsort erreichen.
Das zeigten Forschende aus den USA am Beispiel der Parkinson Krankheit. Parkinson ist eine neurodegenerative Krankheit, bei der bestimmte Zellen in Gehirn absterben, was schließlich zu einem Mangel an Dopamin im Gehirn führt.
Dopamin ist ein Neurotransmitter, der die Signalübertragung zwischen benachbarten Nervenzellen vermittelt. Es wird im Gehirn aus der Aminosäure Tyrosin hergestellt. Um den Dopaminmangel bei Parkinson Patienten auszugleichen und die Symptome zu lindern, wird der Wirkstoff Levodopa (kurz L-Dopa) verabreicht.
Die Besiedlung des Darms mit nützlichen, probiotischen Bakterien ist von entscheidender Bedeutung für seine Gesunderhaltung. Die regelmäßige Zufuhr von “positiven” Darmbakterien unterstützt das harmonische Gleichgewicht der Bakterienstämme, denn pathogene Bakterien und Pilze werden von nützlichen Darmbakterien aus ihrem Lebensraum verdrängt. Abdigan Kapseln wurden speziell zu diesem Zweck entwickelt. Sie bieten ein großes Spektrum an hochdosierten Lebendkulturen, die in einer gesunden Darmflora vorkommen. Mit nur einer Kapsel pro Tag leisten Sie so einen entscheidenden Beitrag für Ihre Darmgesundheit. Mehr Info… (gesponsert)
Levodopa ist eine Vorstufe von Dopamin, die die Blut-Hirn-Schranke passiert und leicht zu Dopamin abgebaut werden kann. Dies ist allerdings unerwünscht, falls es zu früh geschieht. Dopamin selbst kann, wie alle neuroaktiven Substanzen, die Blut-Hirn-Schranke nicht passieren, denn das würde einem Kontrollverlust über die Gehirnfunktion gleichkommen. Die Konzentration von Neurotransmittern muss strikt kontrolliert werden.
Körpereigene Enzyme bauen Medikamente um…
Es ist aber nur eine einzige biochemische Reaktion nötig, um aus L-Dopa, das ins Gehirn gelangen kann, Dopamin zu machen, dem der Zutritt verweigert wird: Dem Molekül wird in einer Reaktion eine CO2-Gruppe abgespalten. Diese Reaktion wird von so genannten Decarboxylasen katalysiert und schon lange ist bekannt, dass dazu unsere körpereigenen Decarboxylasen in der Lage sind. Deswegen verabreicht man zusammen mit L-Dopa auch Decarboxylase-Hemmstoffe, wie zum Beispiel Carbidopa. Aber auch Bakterien verfügen über solche Enzyme und diese Hemmstoffe wirken nicht bei bakteriellen Decarboxylasen.
…bakterielle auch
Eine zusätzliche Strategie, die Wirksamkeit der Parkinson Medikamente zu erhöhen ist, sie gleichzeitig mit einem Breitbandantibiotikum zu verabreichen. So lassen sich die bakteriellen Decarboxylasen ausschalten, die den Wirkstoff-Vorläufer aktivieren, bevor er die Blut-Hirn-Schranke passieren kann. Der Nachteil dieser Methode liegt auf der Hand: Nicht nur die Bakterien, die Wirkstoffe unbrauchbar machen, werden getötet, sondern das gesamte Mikrobiom leidet unter der Attacke. Und wiederholte Antibiotikabehandlungen schaden dem Mikrobiom nachhaltig. Sie stellen sogar einen Risikofaktor für die spätere Entstehung der Parkinson Krankheit selbst dar.
Die Medikamente brauchen Schutz
Es wäre also klug, solche Rundumschläge zu vermeiden und gezielt die Aktivität zu hemmen, die Dopamin schon im Darm bildet, wo es nicht gebraucht wird.
Man muss also einen Hemmstoff finden, der gezielt die Aktivität der bakteriellen Decarboxylasen hemmt. Aber um welche Bakterien handelt es sich hier überhaupt?
Um das herauszufinden durchsuchten Forschende unser gesamtes mikrobielles Genom nach Sequenzen für Tyrosin-Decarboxylasen (TDC), die L-Dopa in Dopamin umwandeln könnten. Sie entdeckten, dass vor allem Bakterien der Gattungen Enterococcus und Lactobacillus L-Dopa bereits im Dünndarm zu Dopamin umwandeln. Sie konnten außerdem zeigen, dass die wirksame L-Dopa Dosis bei Parkinson Patienten positiv mit der Anzahl der in Stuhlproben gefundenen tdc Gene korreliert. Je mehr Tyrosin-Decarboxylasen vorhanden sind, desto höher war die wirksame Dosis von L-Dopa für die Patienten.
Auch im Dickdarm gibt es übrigens Bakterien, die L-Dopa abbauen. Sie gehen dabei einen anderen Weg und spalten dem Molekül eine Hydroxyl-Gruppe ab. Für die Behandlung der Parkinson Krankheit sind sie außerdem nicht relevant, weil die Resorption der Wirkstoffe schon im Dünndarm stattfindet.
Praktische Anwendung
Wie kann man nun gezielt die bakterielle Tyrosindecarboxylase Aktivität im Darm lahmlegen? Viele Enzyme können durch Moleküle inaktiviert werden, die ihrem Substrat ähneln. Und so wurden auch unsere Forscher fündig. Sie fanden, dass (S)-a-Fluormethyltyrosin, oder kurz AFMT, das eine hohe Ähnlichkeit mit Tyrosin besitzt, den Abbau von L-Dopa durch Enterococcus faecalis komplett hemmt. Tierversuche lieferten dann den endgültigen Beweis und zeigten, dass durch die gleichzeitige Gabe von Carbidopa, welches die tierische, und AMFT, das die bakterielle Tyrosin-Decarboxylase hemmt, der Spiegel von L-Dopa im Blutserum angehoben werden kann.
Quellen:
Maini Rekdal V, Bess EN, Bisanz JE, Turnbaugh PJ, Balskus EP. Discovery and inhibition of an interspecies gut bacterial pathway for Levodopa metabolism. Science. 2019;364(6445):eaau6323. doi:10.1126/science.aau6323
van Kessel, Sebastiaan P et al. “Gut bacterial tyrosine decarboxylases restrict levels of levodopa in the treatment of Parkinson’s disease.” Nature communications vol. 10,1 310. 18 Jan. 2019, doi:10.1038/s41467-019-08294-y
Mertsalmi, T.H., Pekkonen, E. and Scheperjans, F. (2020), Antibiotic Exposure and Risk of Parkinson’s Disease in Finland: A Nationwide Case‐Control Study. Mov Disord, 35: 431-442. doi:10.1002/mds.27924
Fotonachweis: (c) adobe media, Pharmacist holding medicine box and capsule pack in pharmacy drugstore, von Viewfinder
AUTOR
Dr. Evelyn Zientz
KATEGORIE
Mikrobiom
GEPOSTED AM
02. September 2020
Aktuelle Beiträge
FODMAP-Diät und Reizdarmsyndrom
Wie wirken FODMAPs wirklich bei Reizdarm? Wer unter einem Reizdarm leidet, dem wird in der Regel die so genannte FODMAP Diät empfohlen. Sie soll für die Patienten besonders gut Mehr lesen!
Krank ohne Diagnose: Die Dünndarmfehlbesiedelung (SIBO)
Die Dünndarmfehlbesiedlung (SIBO) wird oft verkannt Grundsätzlich gibt es viele nützliche Bakterien in der Darmregion. Allerdings sollten diese sich nicht in übermäßiger Anzahl im Dünndarm aufhalten – sonst spricht Mehr lesen!
Wie ein Darmbakterium das Gewicht reguliert
Akkermansia hält uns schlank und gesund Das menschliche Darm-Mikrobiom tritt in letzter Zeit zunehmend als Mediator zwischen Gesundheit und Krankheit seines Wirtes hervor und das Bakterium Akkermansia muciniphila scheint Mehr lesen!
Die Darmflora in der Altersforschung
Wie unser Darm-Mikrobiom uns alt aussehen lässt Die Bedeutung der Gemeinschaft unserer Darmbakterien auf unsere Gesundheit wurde lange unterschätzt. Heute ist bekannt, wie wichtig ein gesundes Mikrobiom auch für Mehr lesen!
Mikrobiom und Medikamente
Wenn Darmbakterien die Medizin sabotieren Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum es so viele Medikamente gegen ein und dieselbe Krankheit gibt? Und warum ein bestimmter Wirkstoff bei einem Mehr lesen!
Studie: Mikrobielle Darmbesiedelung hilft bei Depressionen
Zustand der Darmflora beeinflusst Gehirn und Nerven Einem Bericht der Brighton & Sussex Medical School (www.bsms.ac.uk) zufolge haben Pro- und Präbiotika einen positiven Einfluss auf die Darm-Hirn-Achse (Gut-brain-axis), über Mehr lesen!