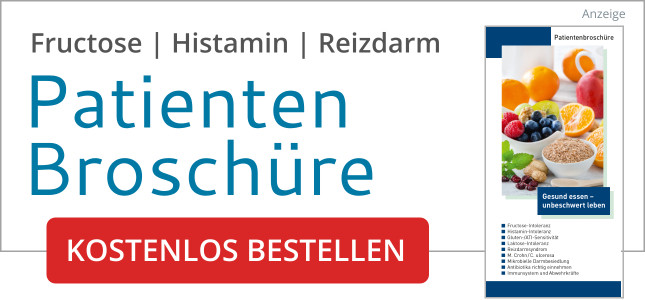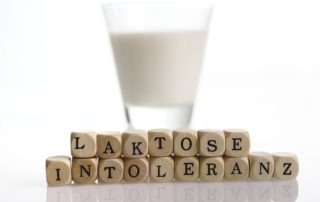Verdacht auf Reizdarmsyndrom?
Die Leitlinie, die Medizinern dabei helfen soll, das Reizdarmsyndrom möglichst eindeutig zu diagnostizieren oder auszuschließen, ist ausgelaufen. Ein neues Manuskript wurde bereits von der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten e.V. (DGVS) und der Deutschen Gesellschaft für Neurogastroenterologie und Motilität (DGNM) in Zusammenarbeit mit weiteren Abteilungen erstellt und eingereicht. Nun steht die Revision dieser Leitlinie an. Sie ist eine Handreichung für Mediziner, um abzuklären, ob es sich bei den vorliegenden Symptomen um Hinweise auf das Reizdarmsyndrom handelt oder, ob sich ein anderes Krankheitsbild dahinter verbirgt.
Das Reizdarmsyndrom: Das steckt dahinter
Symptome einer funktionellen Störung
Das Reizdarmsyndrom, das mit den Buchstaben RDS abgekürzt wird, ist eine Erkrankung des Verdauungstrakts. Einen eindeutigen Grund, warum sich diese Krankheit entwickelt, konnten Mediziner bis heute nicht formulieren. Stattdessen könnten viele verschiedene Gründe zusammenwirken – etwa Nahrungsmittelunverträglichkeiten, psychische Gründe oder Infektionen – und zum Reizdarmsyndrom führen. Die unterschiedlichen Krankheitsauslöser führten letztlich auch zur Ausbildung unterschiedlicher Reizdarmtypen, bei denen sich vor allem die Symptome unterscheiden.
Die Besiedlung des Darms mit nützlichen, probiotischen Bakterien ist von entscheidender Bedeutung für seine Gesunderhaltung. Die regelmäßige Zufuhr von “positiven” Darmbakterien unterstützt das harmonische Gleichgewicht der Bakterienstämme, denn pathogene Bakterien und Pilze werden von nützlichen Darmbakterien aus ihrem Lebensraum verdrängt. Abdigan Kapseln wurden speziell zu diesem Zweck entwickelt. Sie bieten ein großes Spektrum an hochdosierten Lebendkulturen, die in einer gesunden Darmflora vorkommen. Mit nur einer Kapsel pro Tag leisten Sie so einen entscheidenden Beitrag für Ihre Darmgesundheit. Mehr Info… (gesponsert)
Die bekanntesten Symptome könnten nicht unspezifischer sein, denn das Reizdarmsyndrom zeichnet sich durch Durchfall, Blähungen und Verstopfungen aus, die über mehrere Monate hinweg andauern können und die Lebensqualität erheblich einschränken. Aufgabe des Arztes ist es beim Auftreten dieser Symptome herauszufinden, ob das Reizdarmsyndrom Auslöser der Beschwerden ist oder ob eine Infektion oder eine Entzündung die Darmkrankheit bedingen.
Diagnostik des Reizdarmsyndroms
So geht der Arzt vor
Um auszuschließen, dass eine andere Erkrankung der Darmregion die Symptome auslöst, gehen Mediziner Schritt für Schritt vor: Zunächst erfolgt die Basisdiagnostik, dann das Ausschlussverfahren von diversen Symptomen, die für bzw. gegen das Reizdarmsyndrom sprechen. Bis 2015 gab es für dieses Ausschlussverfahren die sogenannte Leitlinie zum Reizdarmsyndrom, die bis dato die Registriernummer 021/016 trug. Nun liegt die überarbeitete Fassung dieser Leitlinie vor, die künftig als Handreichung von Medizinern genutzt werden soll, um das Reizdarmsyndrom zu diagnostizieren und den Betroffenen im Umgang mit den Symptomen zu helfen.
Vor der Abwägung mithilfe der neuen Leitlinie steht die Basisdiagnostik
Bevor die Abwägung erfolgt, ob es sich um das Reizdarmsyndrom handelt oder um eine Krankheit mit ähnlichen Symptomen, müssen sich Patienten mit Verdacht auf das Reizdarmsyndrom auf diese Basisdiagnostik einstellen:
- Anamnese: Blick auf Symptome, Medikamenteneinnahme, Ernährung, psychosoziale Faktoren
- Untersuchung: Sonographie, Koloskopie; gynäkologische Untersuchung bei Frauen
- Labor: Test auf Zöliakie, Stuhluntersuchung auf Keime
Rein statistisch betrachtet leiden etwa zehn bis 15 Prozent der Bevölkerung am Reizdarmsyndrom; Frauen sind doppelt so oft betroffen wie Männer. Wie die Betroffenen mit dem Reizdarmsyndrom umgehen, ist höchst unterschiedlich.
Etwa die Hälfte der Betroffenen fühlt sich durch die Darmerkrankung eingeschränkt und sucht nach medizinischem Rat sowie einer Therapieform, die die Symptome lindern kann.
Unabhängig von den unterschiedlichen Arten des Reizdarmsyndroms sind sich Mediziner heute einig, dass das Zusammenspiel von Bauch, Psyche und Gehirn eine spezielle Bedeutung beim Reizdarmsyndrom zukommen kann. Das Nervensystem im Darm sei, so Mediziner, beim Reizdarmsyndrom überaktiv. Das führt zu den bekannten Reizdarm-Symptomen einerseits und kann auch die Psyche belasten. Angststörungen, Stress und Depressionen können zu Nebenerscheinungen des Reizdarmsyndroms werden.
Die Ärzte stellen diese Ausschlusskriterien in den Fokus der neuen Leitlinie
In der zur Revision vorliegenden Leitlinie sind diese Themenbereiche dokumentiert, die es zu untersuchen gilt, um herauszufinden, ob es sich bei den Krankheitssymptomen um Symptome des Reizdarmsyndroms handelt:
- Definition, Epidemiologie, Verlauf, Prognose, Schweregrad, Lebensqualität
- Pathogenese, Pathophysiologie
- Diagnostik
- Stress und Psyche
- Ernährung
- Therapie von Schmerzen und Diarrhoe sowie von Obstipation und Meteorismus
- Pädiatrie
- Motilitätsstörung in Dick- und Dünndarm
Die Aufbereitung dieser Themenkomplexe, die Teil der neuen Leitlinie sind, soll dabei helfen Krankheiten systematisch auszuschließen, die dieselben Symptome zeigen wie das Reizdarmsyndrom, aber sowohl eine andere Ursache haben als auch eine andere Behandlung benötigen. So könnten beispielsweise gut- und bösartige Geschwülste, sogenannten neuroendokrine Tumore, Reizdarmbeschwerden auslösen. Die Beschwerden können auch ein Hinweis auf Eierstockkrebs oder Gluten-Unverträglichkeit (Zöliakie) sein, auf eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung, wie beispielsweise Morbus Crohn, hinweisen oder auf eine Fehlbesiedlung des Darms aufmerksam machen. Auch Funktionsstörungen oder Veränderungen des Verdauungstrakts können sich mit Diarrhö, Blähungen und Verstopfungen äußern – ebenso wie diese Symptome häufig als Nebenwirkungen unterschiedlicher Medikamente auftreten.
Foto: Neue Diagnoseleitlinie des Reizdarmsyndroms, (c) adobe media, von smolaw11
AUTORIN
Steffi Brand
KATEGORIE
Mikrobiom
GEPOSTED AM
02. Januar 2021
Aktuelle Beiträge
Muskeln und das Mikrobiom
Wie die Darmflora Kraft und Ausdauer beeinflusst Von Dr. Evelyn Zientz Wir sind schon ziemlich toll, aber ohne unser Mikrobiom sind wir nichts. Die Mikrobiologie als Forschungsrichtung der Biologie Mehr lesen!
Wechselwirkung zwischen Arzneimitteln und Mikrobiom
Darmbakterien speichern Medikamentenwirkstoffe Von Dr. Evelyn Zientz Wenn wir Medikamente einnehmen, behandeln wir damit nicht nur uns, sondern auch das Mikrobiom in unserem Darm. Bei einer Antibiotikabehandlung ist uns Mehr lesen!
Dank Corona haben Säuglinge es schwer, ein gesundes Darm-Mikrobiom aufzubauen
Auswirkungen von Corona-Maßnahmen und Covid-19 auf Neugeborene und Babys Von Dr. Evelyn Zientz Kinder kommen bei Covid-19 sehr glimpflich davon. Sie erleben in der Regel einen sehr milden Verlauf Mehr lesen!
Sorbit, Aspartam & Co
Künstliche Süßstoffe – Fluch oder Segen? Von Dr. Evelyn Zientz Wir lieben süßen Geschmack, aber zu viel Zucker ist nicht gesund. Was ist die Entdeckung künstlicher Süßstoffe dann doch Mehr lesen!
Das menschliche Virom
Viren als Bestandteil des gesunden Mikrobioms Von Dr. Evelyn Zientz Das Darm Mikrobiom ist aktuell in aller Munde und seine weitreichende Wirkung auf die Gesundheit seines Wirtes wird zurzeit Mehr lesen!
Covid + Laktose: Die wichtigsten Erkenntnisse auf einen Blick
Corona und Laktoseintoleranz Klare Fakten und eine eindeutige Studienlage kann es zum Zusammenhang von Laktoseintoleranz und Corona (noch) nicht geben. Zu jung ist das Virus. Zu jung ist aber Mehr lesen!